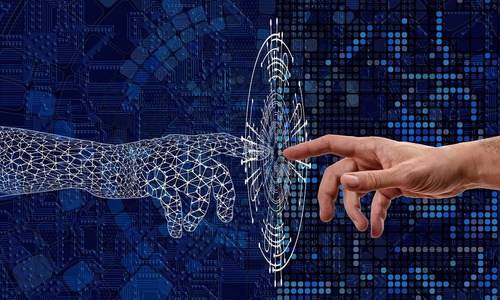News & Insights
KI in der Softwareentwicklung: Zwischen Produktivität und neuen Rollen
KI ist in der Softwareentwicklung längst kein Zukunftsthema mehr, sondern Teil des Alltags. Immer mehr Entwickler:innen greifen auf intelligente Assis...
Harvey Nash ernennt Simon Crichton zum CEO, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben
Der Technology Recruiting Spezialist stärkt sein Führungsteam mit einem erfahrenem Branchenexperten im Rahmen seiner Wachstumsstrategie.
LONDON, [30. ...
Zukunftssichere Jobs: Gefragte Skills im KI-Zeitalter
Welche Berufe haben auch in Zukunft Bestand? In Zeiten von Automatisierung, Künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation beschäftigt diese Fra...
IT-Bewerbung: So präsentieren Sie sich überzeugend
Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte boomt – dennoch ist eine professionelle IT-Bewerbung entscheidend, um Ihren Traumjob in der Informatik zu bekommen....
Cloud Computing im Überblick: Technologien, Modelle & Karrierechancen
Cloud Computing ist in der digitalen Welt von heute allgegenwärtig. Tatsächlich nutzen Mitte 2025 bereits 90 % der Unternehmen in Deutschland Cloud-An...
Künstliche Intelligenz in der IT & ihre Bedeutung für den Arbeitsmarkt
Der Digital Leadership Report zu den Technologie Trends 2025 zeigt, wie künstliche Intelligenz (KI) die IT-Branche in rasantem Tempo verändert. Ob Dat...
Künstliche Intelligenz verursacht den größten IT-Fachkräftemangel seit über 15 Jahren – zeigt Bericht von Nash Squared/Harvey Nash
KI wird zur weltweit gefragtesten Tech-Kompetenz – in Rekordzeit
Bereits die Hälfte aller IT-Führungskräfte meldet einen Mangel an KI-Fachkräften
Ursa...
IT-Jobmarkt im Wandel: Diese Tech-Skills boomen in Deutschland
Der IT-Arbeitsmarkt bleibt in Bewegung, und je nach Region, Unternehmensgröße und Branche variieren die gefragtesten Tech-Skills stark. Welche Technol...
Jetzt an der Umfrage für den Digital Leadership Report 2025 teilnehmen und exklusive Einblicke erhalten!
Harvey Nash und Nash Squared laden Sie herzlich ein, an der neuen Ausgabe unseres renommierten Digital Leadership Reports teilzunehmen. Bereits seit ü...
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Ihren nächsten Karriereschritt gehen möchten oder auf der Suche sind nach passenden Expert:innen für Ihr Team, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Kontaktieren Sie uns gerne, um noch heute mit einem unserer Berater:innen zu sprechen.